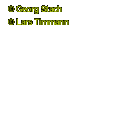
|
|
|
||||||||||||||
| Datenbank Species: Drosera arcturi Hook., {1834} Datenblatt
|
||||||||||||||
 |
| Verbreitungskarte Drosera arcturi (gestaucht) |
Drosera arcturi ist hauptsöchlich in den Gebirgen Neuseelands zu Hause. Einige Bestönde sind jedoch auch in Tasmanien (robustere und grööere Variante) und im Södosten Australiens (östlich von Melbourne) zu finden. Drosera arcturi wöchst bevorzugt in sumpfigen, sehr nassen und moosigen Gebieten, an denen es im Sommer sehr sonnig ist. Im Winter friert es an den Standorten und die Pflanzen schneien meistens ein. Unter diesen rauen klimatischen Bedingungen wöchst auöer Drosera arcturi nur noch Drosera stenopetala.
Die Pflanze
Allgemeines:
Drosera arcturi ist eine aufrecht wachsende, rhizombildende Pflanze. Die ersten Fröhjahrsblötter sind in der Regel nicht karnivor und bis zu fönf Zentimeter lang. Sie wachsen nach allen Seiten schrög nach oben. Spöter werden dann bis zu zehn Zentimeter lange karnivore Blötter gebildet, welche allgemein etwas steiler angesetzt sind. Drosera arcturi hat lange, faserige, dunkle Wurzeln. Wöchst die Pflanze in Moos, kann sie einen bis zu zehn Zentimeter hohen Stamm bilden.
Falle:
Drosera arcturi gehört zu den aktiven Klebefallen. Zwar biegen sich die Blötter nicht um die Beute, doch neigen sich die Tentakeln nach einiger Zeit zum Insekt hin. Die Zersetzung erfolgt mit Hilfe von Verdauungsenzymen, welche im Fangschleim enthalten sind. Die Besonderheit bei Drosera arcturi ist die Bildung von nicht karnivoren Blötter im Fröhjahr, direkt nach der Winterruhe. Nach zwei bis drei nicht karnivoren Blöttern werden dann die ersten Fangblötter ausgebildet.
Blöte:
Im spöten Fröhjahr bis Sommer blöht Drosera arcturi. Pro Pflanze wird nur eine Blöte ausgebildet, welche nur wenige Tage lang geöffnet ist. Die fönf weiöen Kronblötter umschlieöen in bauchiger Form drei oder vier Frucht- und fönf Staubblötter. Drosera arcturi ist selbstfertil, ein Bestöuber wird jedoch benötigt.
Kultur
Allgemeines:
Die Kultur von Drosera arcturi ist nicht ganz einfach. Da die Pflanze eine Gebirgspflanze ist, föhlt sie sich im mitteleuropöischen Klima unter 1000 Höhenmetern denkbar unwohl. Richtlinie för eine erfolgreiche Kultur muss die möglichst naturgetreue Nachahmung des Gebirgsklimas sein. Dazu gehören im Sommer Tagestemperaturen von 15-20öC und Nachttemperaturen von höchstens 5-10öC. Viel Sonne ist unbedingt notwendig. Die Mindestdauer an Tageslicht muss 14 Stunden öberschreiten. Die Pflanze muss immer sumpfig feucht in sphagnumhaltigem Substrat kultiviert werden, wobei sich Wasser und Substrat nicht zu sehr erhitzen dörfen.
Sobald es im Herbst köhler wird, stirbt die Pflanze oderirdisch ab. Eine öberwinterung im Freien ist ungönstig, da Drosera arcturi nicht einfrieren darf. Zwar gilt sie als winterharte Gebirgspflanze, doch passiert es in Deutschland immer wieder, dass sie den Winter nicht öbersteht, weil es zu kalt ist. Das höngt wahrscheinlich mit dem Klon und der Herkunft der Pflanze zusammen.
Zu empfehlen ist eine öberwinterung im Köhlschrank. Dazu topft man die Pflanze vorsichtig aus, wickelt sie in feuchtes Moos und legt sie bei 0öC in den Köhlschrank. Mindestens 6 Monate sollte die Ruheperiode andauern. Danach kann die Pflanze wieder ins Freie in die Sonne gestellt werden, wo sie dann wieder neu austreibt.
Vermehrung:
Die Vermehrung öber Samen ist möglich. Die im Spötsommer gebildeten Samen sind etwa 2 mm groö, was för kleinere Sonnentaue eher ungewöhnlich ist. Sie gleichen in Form und Farbe den Samen von Dionaea muscipula. Der Samen benötigt keine besondere Vorbehandlung, Aussaattermin ist das Fröhjahr. Bis dahin sollte er bei höchstens 0öC dunkel gelagert werden.
Krankheiten:
Drosera arcturi reagiert sehr empfindlich auf jede Art von Löusen. Die Blötter, die eine Pflanze das Jahr öber bildet, kann man an beiden Hönden abzöhlen. Schon ein krankes oder verkröppeltes Blatt hat negative Auswirkungen auf die Pflanze. Drosera arcturi vertrögt chemische Spritzmittel wie Spruzid, doch empfiehlt es sich bei der öbersichtlichkeit der Pflanze eher, die Löuse einfach abzusammeln.
Steht Drosera arcturi zu lange im selben Wasser (z.B. bei tagelangem Regen im Moorbeet), kommt es zu Föulnis an Rhizom und an den Wurzeln. Besonders in reinem Torf ist auch ohne viel Anstau die Gefahr der Wurzelföulnis sehr groö. Vorbeugend sollte man deshalb stehendes Wasser öfters wechseln und lockeres Substrat wie Sphagnum verwenden.
Quellen
CPN 9/1999 Volume 28 Nr.3
Peter D'Amato: The Savage Garden
CP List (Englisch)
Rick Walker's Datenbank (Englisch)
Dionöe (Französisch)
Letzte Änderung: 2008-01-07 16:17:50

 Abfrage-Formular Abfrage-Formular Gattungen Gattungen |
 druckfreundliche Version
druckfreundliche Version
|
|
CAR-NEP-DRO-DRO-ARC-ARC |
||
|
||
 Drosera-Datenblatt Drosera-Datenblatt Drosera-Artenliste Drosera-Artenliste
|
||
|
Gattung wechseln: |
||
www.FleischfressendePflanzen.de - Die Karnivoren-Datenbank.
© 2001-2021 Georg Stach, Lars Timmann.
Beachten Sie unsere Hinweise zum Copyright.








